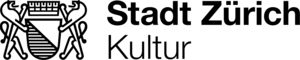Phyllida Barlow
demo
Dreiteilige Serie von SRF Kulturplatz über den Aufbau der Ausstellung. Ausstellungsbesprechungen: Aoife Rosenmeyer in Art in America; eine Gruppe Besuchern für Brand-New-Life; Laura Wurth in KubaParis; Adam Jaspers im artforum. Hier geht es zum Ausstellungsführer
Die britische Künstlerin Phyllida Barlow hat eine eigenartige und einzigartige Karriere hinter sich. 1944 in Newcastle upon Tyne geboren, stellte sie 1965 erstmals aus und zwar im damals angesagten ICA (Institute of Contemporary Arts) in London. Von einem breiteren Publikum wahrgenommen, gesammelt und geschätzt wird ihre Arbeit aber erst seit etwas mehr als zehn Jahren. Dazwischen liegen fünf Jahrzehnte, aus denen sich nur wenige Werke erhalten haben. So haben wir es mit einer Künstlerin zu tun, die heute zwar von vielen als bedeutend betrachtet wird, deren Werk aber zu einem grossen Teil für immer verloren bleibt.
Die Gründe für diese kunsthistorisch recht einzigartige Situation sind vielfältig. Viele von Barlows Skulpturen konnten wegen ihrer Grösse und Beschaffenheit nicht erhalten werden. Denn es gab dafür weder Stauraum noch Geld und offenbar auch keine Käufer. Das änderte sich erst Anfang 2000, als sich Institutionen, Sammler und Galerien für die Künstlerin zu interessieren begannen. Ein zweiter Grund liegt in der Beschaffenheit der Kunst selbst. Barlow vertritt dezidiert die Haltung einer klassischen Bildhauerin. Es geht ihr um die Skulptur, um ihre Bestandteile, ihre Möglichkeiten, Geschichte und Widersprüche. Dabei verwendet sie jedoch Materialien, Formen und Farben, welche immer wieder mit den klassischen Vorstellungen von Skulptur brechen: Statt Bronze oder Marmor sind es Pappkarton, roher Zement und Bauholz, statt gediegenen Volumen sind es zerklüftete und rohe Gebilde und statt dass die Farbe vereint, besänftigt und dekoriert, bricht sie auf, macht sie deutlich und entwickelt ein Eigenleben. Daraus aber beziehen ihre Werke eine Spannung wie nur wenige sonst – womit es noch länger brauchte, bis ihre formalen und skulpturalen Qualitäten wahrgenommen wurden. Barlows Kunst verteilt keine Komplimente, sie verweigert sich der Bewunderung, sie stellt sich in den Weg und der Architektur entgegen und widersetzt sich gängigen Vorstellungen von Wert, Geschmack und Status. Dieser Widerstand wiederum verleiht ihr eine politische Dimension.
Die Ausstellung in der Kunsthalle Zürich heisst demo – wie in demo-lieren, Demo-kratie oder Demo-nstration. Unter der Leitung der Künstlerin wurden zwei massive skulpturale Interventionen aufgebaut. Es beginnt im 2. Stock mit einer Skulptur, die drei Räume in Beschlag nimmt und von den Besucherinnen und Besuchern eine «körperliche» Betrachtung einfordert: Wir müssen aufpassen, nicht zu stolpern, wollen aber den Kopf immer gegen die Decke richten. Denn dort sind die Skulpturen angebracht, schwebend eingelassen in ein Dickicht von Latten und Pfählen. Manchmal denken wir, alles zu sehen, dabei haben wir den Überblick längst verloren. Hier wird einseh- und erfahrbar wie Skulptur funktioniert, wie sie sich im Gehen erschliesst (und wieder entzieht), wie sie mit Architektur spielt, ihr widerspricht und gegen sie antritt. Und wie banalste Materialien durch Formgebung brillieren und unsere Sehweisen auf den Kopf stellen.
Im 3. Stock ändert sich alles. Dort betritt man die Kunsthalle sozusagen von der falschen Seite, das heisst vom Notausgang her. Dieser führt in einen geschlossenen Raum, darin befindet sich ein Ding zwischen Bühne, Podium und Skulptur. Von dort aus bietet sich den Besucherinnen und Besuchern durch röhrenartige Löcher in der Wand einen Blick auf eine sich über den Boden ausbreitende Skulptur aus zerstörten Wandelementen, heruntergerissenem Isolationsmaterial und verbogenen Aluminiumkanälen. Es ist eine Art apokalyptische Landschaft, die sich nie ganz erschliessen lässt, es ist eine tonnenschwere Skulptur, die sich uns entzieht und selber aber auch bedroht ist: Im Hintergrund werden nämlich wegen Renovationsarbeiten während der Ausstellung die Wände heruntergerissen und neu aufgebaut. Baustaub wird die Landschaft bedecken, Lärm wird herüberdringen und Arbeiter werden manchmal sichtbar sein – bevor die Arbeit am Ende der Ausstellung entsorgt wird. Damit verschränken sich in der Kunsthalle Zürich erstmals die beiden so zentralen Momente von Barlows Karriere und Kunst: Die Skulptur als Fremdkörper, als Abbruch und Schatten. DB
2017 vertritt Phyllida Barlow Grossbritannien an der Biennale von Venedig.
Mehr Informationen über Phyllida Barlow finden Sie in unserem Saalführer.
A walk through demo by Phyllida Barlow